In diesem Blogbeitrag möchte ich so offen wie möglich über den Tag erzählen, der mein Leben für immer verändert hat. An diesem Tag verlor ich nicht nur meinen jüngsten Sohn durch Suizid, sondern auch einen Teil von mir selbst. Es war ein Moment, der alles in Frage stellte, was ich für sicher hielt und seitdem ist nichts mehr so, wie es einmal war – und es wird auch nie mehr so sein.

Die Nachricht kam wie ein Schlag ins Gesicht. Ich erinnere mich an den Schock, die Leere in meinem Inneren und das Gefühl, dass die Welt um mich herum stillstand. An diesem Tag begann eine Reise durch unvorstellbare Trauer und Schmerz, die ich mir nie hätte vorstellen können. Der Verlust meines Sohnes hat nicht nur meine Familie, sondern auch mich als Mensch verändert.
Donnerstag, 21.10.21 – ein Tag wie jeder andere. Nein, dieses Datum wird sich in mein Herz einbrennen wie kein anderes. Als das Telefon klingelte und ich die Nummer meiner Schwiegertochter auf dem Display sah, ahnte ich nicht, dass dieses Gespräch mein Leben für immer verändern würde. Ich nahm das Gespräch an, in der Hoffnung auf ein lockeres Gespräch zwischen ihr, mir, meinem Sohn, sowie meiner Enkeltochter. Doch was ich dann zu hören bekam, veränderte mein weiteres Leben bis heute.
Ich nahm den Hörer ab, ahnte nichts – und doch zitterte etwas in mir, noch bevor sie sprach. Ihre Stimme war kaum wiederzuerkennen – aufgelöst, überschlagen, voller Angst. Und dann sagte sie es. Diese Worte, die mir das Herz zerrissen, noch bevor ich sie ganz verstand.
Mein Sohn…
Er wäre in einem kritischen Zustand…
Im Sterben.
Die Rettung sei unterwegs.
In diesem Moment zerfiel meine Welt in tausend Scherben. Es war, als würde jemand den Boden unter meinen Füßen wegreißen. Ich hörte ihre Worte, aber sie kamen nicht wirklich bei mir an. Es war, als würde alles durch eine dicke Wand aus Watte zu mir dringen – dumpf, verlangsamt, unwirklich. Mein Herz schlug so laut in meiner Brust, dass es alles andere übertönte. Ich konnte nicht atmen. Ich konnte nicht denken.
Die Luft um mich herum wurde plötzlich schwer, fast erstickend. Meine Beine gaben nach, meine Hände begannen zu zittern. Ich wusste nicht, wohin mit mir, mit diesem entsetzlichen Schmerz, der sich schlagartig in mir ausbreitete. Es fühlte sich an, als würde etwas in mir zerreißen, ein unhörbarer Schrei tief aus meinem Inneren – roh, wild, ohnmächtig.
Ich stand da, mitten im Raum, aber gleichzeitig war ich nirgends. Die Zeit hatte aufgehört zu existieren. Alles war nur noch Stille und Lärm zugleich – das Dröhnen meines Herzens, das Rauschen in meinen Ohren, die schier unerträgliche Erkenntnis, dass etwas Schreckliches geschieht… und ich nichts tun konnte.
Ein unsichtbarer Nebel legte sich über meinen Verstand, über meine Gedanken, meine Wahrnehmung. Ich war wie betäubt. Und doch spürte ich jeden einzelnen Schmerz, jede Faser meines Körpers schrie – aber ich konnte keinen Ton von mir geben.
Ein Gedanke kroch langsam in mein Bewusstsein. Langsam. Quälend langsam.
Ein Gedanke, der mein Herz einfrieren ließ:
Ich könnte ihn verlieren.
Mein Kind. Mein Junge.
Und in mir entstand eine Leere, so groß und dunkel, dass ich glaubte, nie wieder herauszufinden.
Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich so dastand – reglos, wie erstarrt, nur dieser Schmerz in mir, alles andere ausgeblendet. Mein Blick war leer, mein Körper fühlte sich an, als gehöre er nicht mehr zu mir.
Und dann kam mein Mann in den Raum.
Er sagte nichts, zumindest erinnere ich mich nicht an Worte. Vielleicht sah er es einfach in meinem Gesicht – dieses absolute Entsetzen, diese Hilflosigkeit, die mich völlig überrollt hatte. Ich glaube, in dem Moment verstand er sofort, dass etwas Unvorstellbares passiert war.
Ich sah ihn an – oder vielmehr durch ihn hindurch – und versuchte etwas zu sagen, aber meine Stimme versagte. Es kam nur ein tonloses Flüstern über meine Lippen: „Es ist Thomas…“ Dann brach ich in seinen Armen zusammen.
Ich weiß noch, wie er mich festhielt, so fest, als wollte er mich vor dem Zerbrechen bewahren. Doch ich zerbrach trotzdem – innerlich, stumm, Stück für Stück. Ich spürte, wie auch in ihm die Angst aufstieg, dieser lähmende Schock, doch er versuchte, stark zu bleiben. Für mich. Für uns.
Seine Umarmung war in diesem Moment mein einziger Halt – ein dünner Faden zwischen mir und dem völligen Zusammenbruch. Ich hörte ihn etwas sagen: doch ich weiß es nicht mehr- denn diese Worte erreichten mich kaum. Mein Inneres war längst in eine andere Welt abgedriftet – eine Welt aus Schmerz, Dunkelheit und dem Gefühl, dass nichts je wieder gut werden kann.
Ich weinte nicht. Ich konnte nicht. Die Tränen kamen später. Viel später. Zuerst war da nur diese unendliche Leere, wie ein Vakuum in meiner Brust, das alles verschluckte: meine Gedanken, meine Kraft, mein Leben.
Es war später Nachmittag, als dieser Anruf mein ganzes Leben zerriss. Und ich wusste sofort – ich muss zu ihm. Nicht morgen. Jetzt. Es gab keine Diskussion, keine Vernunft, kein Warten. Mein Herz schrie förmlich danach, bei meinem Kind zu sein. Jeder würde es verstehen – jeder, der liebt, der Mutter ist.
Doch mein Mann – der mich nur schützen wollte, aus Sorge, aus Angst – bat mich, zu warten. „Wir fahren morgen früh“, sagte er, seine Stimme ruhig, aber ich hörte sie kaum. Für mich war das keine Option.
Wie sollte ich eine Nacht überstehen, wissend, dass mein Kind vielleicht jetzt gerade…
Ich musste los. Es gab keine Wahl, kein Nachdenken. Mein Kopf fuhr Karussell – ich fühlte mich, als würde ich gleichzeitig verbrennen und erfrieren.
In meinem Inneren tobte ein Sturm aus Gedanken, die schneller waren als Worte es je sein könnten.
Ich sah sein Lächeln vor mir. Hörte seine Stimme. Erinnerte mich an unser letztes Gespräch. Dachte an all die Dinge, die wir uns noch sagen wollten.
Und gleichzeitig – diese grauenvolle Erkenntnis: Vielleicht werde ich ihn nie wieder in den Arm nehmen. Nie wieder seine Stimme hören. Nie wieder mit ihm lachen. Nie mehr sein „Hallo Mama“.
All das raste in Sekunden durch meinen Kopf – als hätte jemand ein Fenster zu einer Hölle geöffnet, in die ich ohne Vorwarnung gestoßen wurde.
Ich klammerte mich an die Hoffnung, dass es nicht wahr ist. Dass ich gleich aufwache. Dass jemand mir sagt, es sei ein Irrtum. Ein furchtbarer, aber korrigierbarer Fehler.
Doch tief in mir wusste ich: Nichts wird je wieder so sein wie vorher.
Diese Sekunden, Minuten, Stunden… sie fühlen sich an wie ein ganzes Leben.
Ein Leben im freien Fall.
Und in all dem Schmerz, der Ohnmacht, dem Drang, einfach nur bei ihm zu sein – war da auch diese Stille zwischen den Gedanken, die nur Menschen kennen, die selbst durch dieses Feuer gegangen sind. Diese unaussprechliche Leere, gepaart mit einem verzweifelten Rest von Hoffnung, der sich krampfhaft an einem letzten Funken festhält.
Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich weiß nur: Ich musste zu ihm.
Wir packten schnell ein paar Sachen und machten uns auf den Weg. Ich funktionierte einfach – mechanisch, getrieben von einem einzigen Gedanken: Ich muss zu meinem Kind. Es war keine Frage, kein Zögern. Ich wusste nur: Ich kann nicht stillstehen. Nicht jetzt.

Doch dann klingelte erneut mein Handy. Es war meine Schwiegertochter. Ich nahm ab – mit klopfendem Herzen, mit dieser brennenden Hoffnung, dass sie mir sagen würde: Es geht ihm besser. Er lebt.
Aber ihre Stimme… sie war zerbrochen.
Und dann sagte sie die Worte, die mein Herz zum Stillstand brachten:
„Es war zu spät. Er hat es nicht geschafft.“
In diesem Moment fiel alles in sich zusammen. Ich spürte, wie mein Körper erstarrte – als wäre ich plötzlich aus Glas und müsste jeden Moment zerspringen. Meine Gedanken brachen wie Wellen über mir zusammen und doch war da nur ein einziger Satz, der immer wieder in meinem Kopf flackerte:
„Das kann nicht sein.“
Ich konnte es nicht fassen. Ich wollte es nicht glauben. Ich schrie innerlich, lautlos, während meine Lippen bebten und meine Kehle ein Schluchzen hervorstieß, das aus der tiefsten Tiefe meines Seins kam.
Mein Sohn.
Mein Kind.
Nein.
Das hat er nicht getan.
Er hat uns nicht so verlassen.
Er kann es nicht getan haben.
Immer wieder schrie es in mir: „Nein! Nein! Nein!“
Warum? Wieso? Wie konnte er diesen Schritt gehen? Warum hat er uns nicht gerufen, nicht gewartet?
Mein Verstand wehrte sich, mein Herz rebellierte. Nichts wollte es glauben, nichts akzeptieren. Und bis heute – bis heute – ist da ein Teil in mir, der es immer noch nicht begreifen kann.
Wenn ich sage, dass ich geweint habe, dann klingt das nicht passend. Es war kein gewöhnliches Weinen.
Es war ein Weinen aus der tiefsten Ecke meiner Seele – vermischt mit Schmerz, mit Hoffnung, mit Angst, mit Verzweiflung. Ein Weinen, das keinen Namen hat.
Zwischendurch musste ich telefonieren – mit seinen Brüdern. Ich musste ihnen das Unfassbare mitteilen. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich die Worte über meine Lippen brachte. Mein Körper schluchzte, meine Stimme brach und irgendwo dazwischen rang ich um jedes Wort.
Diese Fahrt…
Diese Fahrt war der Weg in die Hölle.
Und ich wusste damals noch nicht, dass sie nur der Anfang war.
Ein Anfang, der mich in eine Dunkelheit führte, die kein Licht mehr kannte.
Die ganze Fahrt über hörte der Schmerz nicht auf. Die Tränen flossen unaufhörlich, als ob sie nie enden würden. Und doch wissen wir bis heute nicht, wie wir diese 750 Kilometer unbeschadet zurückgelegt haben. Der Weg war lang und schwer, ohne meinen Mann, der den ganzen Weg alleine gefahren ist, hätten wir es vermutlich nicht geschafft, ohne Zwischenfälle an zu kommen.
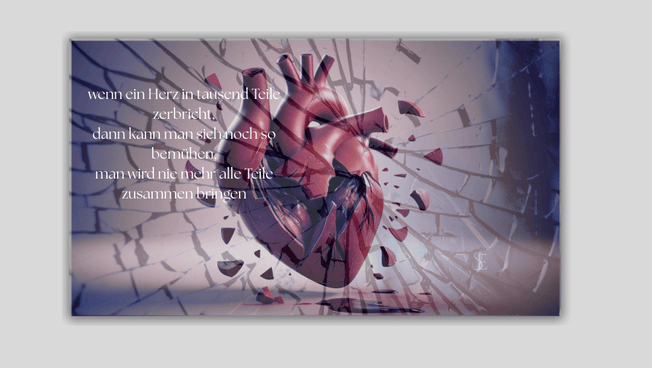
Ich hoffe, dass das Teilen meiner Erfahrungen anderen helfen kann, die ähnliche Tragödien durchleben. Es ist wichtig, über den Schmerz zu sprechen und die Emotionen zuzulassen, die mit einem solchen Verlust einhergehen. Denn auch wenn die Wunden tief sind, gibt es vielleicht einen Weg, mit der Trauer umzugehen und einen neuen Sinn im Leben zu finden.
Verlust fühlt sich oft so an, als würde die Zeit stillstehen. Selbst wenn Wochen, Monate oder Jahre vergehen, bleibt dieser Schmerz frisch und intensiv, als ob er nie wirklich verarbeitet wurde - so ist es auch bei mir. Es ist schwer, die Realität zu akzeptieren, besonders wenn man noch festhält oder hofft, dass sich die Dinge ändern könnten.
Dieser Kampf, den Verlust zu realisieren, zeigt, wie stark dieses Ereignis noch Raum einnimmt. "Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um diesen Schmerz zu durchleben " - sagen Sie. Es ist ein langer Prozess, und es gibt keinen "richtigen" Weg, damit umzugehen. Leider zwingt uns die Gesellschaft oft dazu, weiterzumachen, selbst wenn wir innerlich zerbrechen. Es gibt den Druck, zu funktionieren, zu arbeiten, und den äußeren Erwartungen gerecht zu werden, auch wenn man sich noch mitten im Schmerz befindet. Das kann unglaublich anstrengend und isolierend sein, weil der eigene Schmerz oft nicht den Raum bekommt, den er braucht, um wirklich verarbeitet zu werden.
Es ist, als würde man eine Maske tragen, die Stärke und Anpassung zeigt, während innen das Chaos herrscht. Es ist wichtig, sich selbst in solchen Momenten kleine Inseln der Ruhe und des Rückzugs zu schaffen, in denen man den Schmerz zulassen kann – auch wenn der Alltag weitergeht.
Ich muss ehrlich zugeben, dass es mir noch immer schwerfällt, einen Rückzugsort für mich selbst zu schaffen. Den Schmerz zu verdrängen oder gar nicht erst daran zu denken, scheint auf den ersten Blick der einfachere Weg zu sein. Doch die Wahrheit sieht anders aus – und genau das wird in meinen kommenden Beiträgen deutlich werden.


