Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden, um zu beschreiben, dass mein Sohn nicht mehr bei uns – bei mir – ist. Wie kann ich in Worte fassen, was mir noch immer den Atem raubt? Es fühlt sich an, als wäre ich in einem endlosen Albtraum gefangen, aus dem ich nicht erwachen kann. Wie soll ich trauern, wenn ich den Verlust noch immer nicht akzeptieren kann?
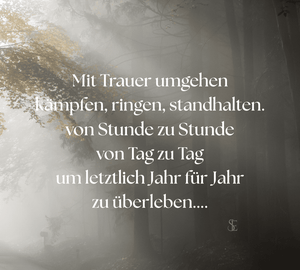
Nichts fühlt sich real an, weder sein Tod noch die Tatsache, dass mein Kind nicht mehr hier bei mir ist. Er war im Ruhrgebiet, ich in Bayern – und doch fühlt es sich immer noch so an, als wäre das alles unverändert.
Natürlich war es die richtige Entscheidung, dass mein Sohn bei seinem zu Hause begraben wurde, um in der Nähe seines Kindes zu sein. Doch welche Mutter wünscht sich nicht, ihr Kind bei sich zu haben, vielleicht wäre die Trauer erträglicher, greifbarer, wenn ich ihn näher bei mir haben können.
Doch ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass der Schock über seinen Tod noch immer so tief in mir sitzt und der Schmerz mein Herz unaufhörlich zerreißt. Die Frage nach dem „Warum“ quält mich und die Schuldgefühle fressen mich innerlich auf. Was hätte ich tun können, um es zu verhindern? Was habe ich übersehen? Diese Gedanken kreisen unaufhörlich in meinem Kopf.
Es gelingt mir einfach nicht, mit der Realität umzugehen. Ich wollte nicht, konnte mich nicht um Trauerbewältigung kümmern. In den ersten Tagen nach dem Tod meines Sohnes, habe ich mich nur um die Formalitäten gekümmert – die Beerdigung, den Ort, all die Details, die so wichtig waren, um ihm einen würdevollen Abschied zu ermöglichen. Der Gedanke, mein Kind nach der Freigabe noch einmal zu sehen, war für mich das Wichtigste. Ich wusste, dass dieser Moment eine Qual werden würde, aber ich musste ihn durchstehen. Hätte ich mein Kind nicht noch einmal gesehen, hätte ich es mein ganzes Leben bereut. Ich hätte nicht gewusst, wie ich mit diesen Selbst-Vorwürfen weiterleben sollte.
Der Tod meines Kindes war das Ende meines alten Lebens – und der Beginn eines schmerzvollen Überlebens.
Am Tag, als mein Sohn ging, blieb die Welt für mich stehen. Da war kein Morgen mehr, kein Weiter, kein Licht. Nur Dunkelheit, Schmerz und ein endloser Schrei in mir, den niemand hören kann. Ich wusste nicht, dass ein Mensch so tief fallen kann – dass man atmen kann und trotzdem innerlich stirbt.
Die Zeit danach war grau und schwer. Ich funktionierte – irgendwie. Ich war da für andere, wenn sie mich brauchten. Zeigte mich stark, obwohl ich innerlich in tausend Stücke zerbrach. Ich lächelte, wenn ich weinen wollte. Ich sprach, wenn ich schreien musste. Und je mehr ich für andere stark sein wollte, desto mehr verdrängte ich meinen eigenen Schmerz. Meine Trauer hatte keinen Platz. Ich schob sie weg, tief hinein, bis sie still wurde – aber nie verschwunden.
Ich lebte weiter. Aber nicht wirklich. Ich war nur noch eine Hülle. Und niemand sah, wie sehr ich litt – weil ich es selbst nicht zuließ.
Doch nachdem alles organisiert war, blieb keine Zeit zum Trauern. Ich musste funktionieren. Im Job, im Alltag, überall sollte ich weiter meinen Aufgaben nachgehen, so als wäre nichts geschehen. Niemand gab mir den Raum, den ich so dringend brauchte, um meinen Schmerz zuzulassen.
Jeden Morgen wache ich auf und hoffe, dass alles nur ein schlechter Traum ist und dass mein Kind vor der Tür steht. Der Schmerz ist immer präsent und die Realität holt mich jedes Mal aufs Neue ein.
Die Überschrift lautet: „Wie gehe ich mit meiner Trauer um?“ Für mich bedeutete das, dass meine Trauer sich in Form von Depressionen, posttraumatischer Belastungsstörung sowie ständigen Angst- und Panikattacken zeigt. Dazu kommt meine Fibromyalgie, die mich in jeder Phase meines Erlebens begleitet – durch die Depressionen und Co. – sich in intensiven, oft kaum erträglichen Schmerzen ausdrückt. Es war, als hätte meine Trauer keinen anderen Weg gefunden, sich zu zeigen und sie begann mich innerlich aufzufressen.
Ich hoffe, dass mir eine lange Therapie helfen wird, den Verlust meines geliebten Sohnes irgendwann zu verarbeiten. Dass ich eines Tages wirklich trauern kann. Noch scheint mir dieser Tag so unendlich weit entfernt.


